365 Tage Kinderrechte im Lockdown – Psychologinnen berichten…
„Die Kinder machen das so toll.“ „Kinder gewöhnen sich so schnell an Veränderungen.“ „Wir müssen doch nur noch ein paar Wochen durchhalten.“ Diese und ähnliche Worte sagen oft Politiker:innen, lesen wir in Zeitungen oder hören sie im Gespräch mit Eltern. Aber ist das tatsächlich so? Sicher gibt es Kinder und Familien, die die „Ausnahmesituation Pandemie“ gut meistern. Aber es gibt auch die vielen anderen, denen es die letzten 12 Monate nicht gut geht. Wir haben zwei Psychologinnen gebeten, uns Einblicke in ihre Arbeit zu geben…
Eine Diplom-Psychologin zu ihrer Arbeit in Kitas und an Schulen
Die (frühe) Kindheit ist ein ungemein spannender Lebensabschnitt. In keiner anderen Lebensphase lernt der Mensch so viel Neues, erwirbt er derart grundlegende Fähigkeiten. Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, sie zu beobachten und zu verstehen, ihrer Neugierde Raum zu lassen, ihnen Sicherheit zu geben, um sie wachsen zu sehen, empfinde ich als wunderbare Aufgabe: Vielfältig, berührend, erstaunlich und immer, immer wieder bereichernd. Das Bewusstsein dafür, dass Erwachsene mit ihrem alltäglichen Handeln Kindern Vieles ermöglichen, aber – im ungünstigen Fall – eben auch Entscheidendes verbauen können, lässt mich meine Arbeit mit viel Respekt vor der Aufgabe und Leidenschaft für die Sache machen. Ich bin Diplom-Psychologin und unterstütze pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten und im offenen Ganztag immer dann, wenn das Verhalten von Kindern Anlass zur Sorge gibt. Ich berate Träger von Bildungseinrichtungen, entwickle pädagogische Konzeptionen für Kitas und Schulbetreuungen, schätze potentielle Gefährdungssituationen ab und bilde pädagogische Fachkräfte fort. Aktuell habe ich viel zu tun!
Die pandemiebedingten Einschränkungen betreffen uns alle, keine Bevölkerungsgruppe aber derart einschneidend wie die Kinder und Jugendlichen. Beschlüsse und Abwägungsentscheidungen werden von Erwachsenen getroffen – aus der erwachsenen Sicht heraus. Es gibt gute Gründe dafür – aber auch gute dagegen. Wie so oft werden die Bedürfnisse der Jüngsten auch in dieser Krise schnell übersehen – weil sie leise, meist indirekt und subtil geäußert werden – und weil es so für uns Erwachsene oft einfacher ist. Das schlechte Gewissen beruhigen wir allzu gerne mit Argumenten wie unsere Entscheidungen seien letztlich zum Wohle der Kinder, stärkten sie und machten ihnen auch gar nicht so viel aus. Manchmal stimmt das, meistens nicht. Ich höre viel zu derzeit: Besorgten Erzieher:innen, Betreuer:innen und Lehrer:innen, die ihr Bestes geben, aber auch große Angst vor Ansteckung haben. Und Eltern, die sich um die Gesundheit ihrer Familie sorgen und angesichts der vielfältigen Anforderungen und Herausforderungen im Berufs- und Familienleben nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Ich kann die Sorgen der Erwachsenen gut verstehen, meine Aufgabe aber ist es, die Nöte der Kinder zu sehen, auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen, Erziehende für ihre Signale zu sensibilisieren und mit aller Kraft und großer Entschlossenheit für ihre Rechte einzutreten.
Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich auf Kinder treffe, deren Entwicklung beeinträchtigt, deren Wohl gefährdet und deren Wohlbefinden nicht gesichert ist. So viele wie aktuell waren es in meinem Arbeitsleben noch nie.

Ich sehe das fünfjährige Mädchen, das im August eingeschult wird. Sie ist gerne ein Vorschulkind und ihr letztes Kitajahr ist wichtig für die Anbahnung eines bedeutenden Übergangs: Abschied nehmen von der Kita, in der sie knapp 5 Jahre lang jeden Werktag etwa sieben Stunden verbracht hat, sich rüsten für den Neuanfang in der Schule, dem sie freudig, aber auch ein bisschen angespannt entgegen sieht. Ihre Kita wird im Herbst aus Infektionsschutzgründen für 14 Tage geschlossen, danach geht die Einrichtung in den sogenannten Pandemiebetrieb: Um Kontakte zu reduzieren, werden die Gruppen der Einrichtung fortan strikt getrennt und Geschwister stets in der gleichen Gruppe betreut.
Das Mädchen hat einen zweijährigen Bruder. Kita-Team und Eltern entscheiden gemeinsam, dass das Vorschulkind – als einzige ihres Jahrgangs – die Gruppe wechselt, denn dem kleinen Bruder traut man den Wechsel – aus guten Gründen – nicht zu. Das jüngste Kind in der neuen Gruppe des Geschwisterpaares ist 14, das älteste 32 Monate alt. Von heute auf morgen ist das Mädchen ohne jede Vorwarnung von ihren gleichaltrigen Spielkameraden und ihrer Gruppenerzieherin abgeschnitten, es gab nicht mal einen Abschied – und auch keine Chance, auf einen begleiteten Neuanfang, denn die Eltern dürfen die Kita derzeit nicht betreten. Die Übergabe erfolgt an der Kitatür. Alle Erwachsenen sind bemüht und froh, dass sich das Mädchen „tapfer“ zeigt. So kann die Kohortentrennung gewährleistet und die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Kitaschließung minimiert werden. Das Mädchen bewältigt den Wechsel scheinbar unbeeindruckt, bis erstmals ein heftiger Wutausbruch auftritt. Seither häufen sich „Ausraster“: Das Mädchen attackiert andere Kinder, scheinbar ohne jeden Anlass, ohne jede Vorwarnung. Die Situation eskaliert, als das Mädchen beim Mittagessen mit der Gabel auf das neben ihr sitzende Kleinkind einsticht.
Da ist der anderhalbjährige Junge, im September frisch eingewöhnt in die Kindertagesstätte. Er hat langsam Vertrauen gefasst, eine Bindung zu seiner Bezugserzieherin aufgebaut und schließlich den neuen Bildungsraum für sich erobert. Dann kam die Kitaschließung. Drei Monate war er zu Hause. Dann der Restart: Übergabe am Zaun an die Bezugserzieherin, die jetzt Schutzkleidung trägt. Ihr Gesicht kann der Junge unter der Maske nicht erkennen. Pandemiebedingt hat sich das Konzept der Einrichtung verändert: Es gibt neue Abläufe und kaum noch vertraute Rituale. Der Junge zeigt deutliches Widerstreben geben die Trennung von seinen Eltern, lässt sich von den Fachkräften nicht beruhigen und findet nicht ins Spiel. Er verweigert die Nahrungsaufnahme in der Kita und beginnt, sich die Haare raus zuziehen.
In der Schulbetreuung treffe ich das siebenjährige Mädchen mit leichter Hörschwäche, die dem Geschehen in der Notbetreuung nicht mehr folgen kann, seit Betreuer und Spielkameraden Masken tragen. Ihr fehlen Mundbild und Mimik für die erfolgreiche Kommunikation. Sie geht zunehmend in den Rückzug und nässt neuerdings ein.
Im Austausch mit Kolleg:innen höre ich, dass sie noch nie zuvor so viele gestresste Kinder gesehen haben wie zur Zeit. Schaue ich in die Kindertagesstätten und Schulbetreuungen, kann auch ich diese Entwicklung sehen: Kinder, die Automanipulationen zeigen – teils so ausgeprägt – dass sie nicht mehr am Spielgeschehen teilhaben können; Kinder, die Tics entwickeln, einnässen, Kopfschlagen, tönen oder schaukeln. Ich sehe massive Trennungs- und ausgeprägte Schulängste – gerade jetzt bei der Wiederaufnahme des Unterrichts im Wechselmodell. Ich sehe Kinder mit Schlafstörungen, motorisch unruhige Kinder und jene, die Förderbedarf, aber keinen Zugang zur Förderung haben. Kinder, die sich auf den Übergang in die weiterführende Schule vorbereiten, ohne diese Schule je von innen gesehen zu haben.
Es sei wichtig, Kitas und Schulen nicht vorschnell zu öffnen, höre ich hier und da einen Erwachsenen sagen. Aus Infektionsschutzgründen! Und auf ein paar Wochen mehr oder weniger komme es jetzt nun auch nicht mehr an. Es ist eine erwachsene Einschätzung. Zeit ist relativ. Als Kind schien mir der Advent unendlich lang; ein ewiges Warten auf Weihnachten. Je älter ich werden, desto schneller verfliegt der Dezember. Drei Monate Kitaschließung bedeuten für den Einjährigen etwas anderes als für mich. Mir scheint es wichtig, dass wir diejenigen, die Abwägungsentscheidungen treffen müssen, ab und an daran erinnern.
Gedanken einer Psychotherapeutin zur Situation von Kindern & Jugendlichen
Ich arbeite in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Seit Beginn der Pandemie hat sich bei uns viel verändert.
Am Anfang war die Stille. Im März 2020 begann der erste Shutdown. Dies war sofort deutlich spürbar. In unseren Ambulanzen, in denen es sonst immer viel zu tun gibt, meldete sich kaum jemand. Wir entließen teilweise Patient:innen von den Stationen und versorgten sie telefonisch oder mit Video-Therapie. Viele Familien, Kinder und Jugendliche kamen mit der ungewöhnlichen und fordernden Situation zunächst gut zurecht und zeigten erstaunliche Coping-Mechanismen. Auch die Familien, bei denen wir befürchteten, dass es für sie schwierig werden könnte. Erst, als die Schulschließungen zunehmend andauerten, zeigten sich bei den Familien einzelne Ermüdungserscheinungen. Kinder mit ADHS versperrten sich zunehmend dem Online Unterricht, Jugendliche waren frustriert von fehlendem Kontakt zu Lehrer:innen, Eltern sprachen die Sorge an, dass ihr Kind das Jahr wiederholen können müsste. Die Kinder fühlten sich deshalb teilweise als Versager:innen. Schulen holten Schüler:innen, von denen ihnen zu wenig Feedback oder erledigte Aufgaben kamen, in den Präsenzunterricht zurück – wenn die Lehrkräfte aufmerksam darauf achteten.
Es folgte der Sommer und die Ruhe vor dem Sturm. Freizeitaktivitäten waren eingeschränkt möglich, wir sahen eine leichte Steigerung an Krisen und Notfällen bei uns in der Klinik, jedoch noch kein Übermaß. Ein Stück weit hatte sich vertraute Normalität eingespielt und von der Pandemie war in der warmen Sonne nur ein Hintergrundrauschen zu spüren.
Dann kam der Sturm. Im Herbst, als es dann erneut zum Shutdown kam und soziale Kontakte wieder stark eingegrenzt wurden, stiegen bei uns die Anrufe und Notfälle abrupt. Bald füllten sich unsere Stationen mit mehr und mehr Notfällen und wir stellten ein zusätzliches Bett zum nächsten. Wir hörten von anderen Kliniken, dass es sich ebenfalls zuspitzte, wir lasen Artikel darüber, dass die Fälle von Anorexie und schweren Störungen zunahmen und sahen dasselbe bei uns.
Seit Dezember 2020 können wir keine Regelbehandlungen mehr anbieten. Die älteren Kolleg:innen sagen, dass sie Vergleichbares in über 20 Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht erlebt haben.
Da ist das neunjährige Kind bei uns auf Station, das immer wieder zu Hause ausgerastet ist. So stark, dass es seine Eltern geschlagen und getreten hat. Die Familie hat sich gemeldet, als die Mutter eine gebrochene Rippe hatte und sie die Polizei dazu geholt haben. Nach Monaten im Home Schooling und Home Office und fehlenden Strukturen, hatten die Eltern keine Kraft mehr, die sie ihrem Kind entgegen setzen können. Eine Struktur aufrecht zu erhalten ohne äußere Struktur gelang nach Monaten nicht mehr.
Da ist der Elfjährige, der auf das Dach der Schule gestiegen ist und drohte, er springe herunter. Da sind die Jugendlichen, die immer wieder suizidal werden und die Frage stellen: Was soll ich denn von dieser Zukunft erwarten?
Da ist die Jugendliche, die mit Sonde ernährt wird und ständig wieder fixiert werden muss. Weil sie sich die Sonde sonst zieht und alles daran setzt, noch weiter abzunehmen. Sie war in der Vergangenheit schon magersüchtig. Hatte sich behandeln lassen, hatte seit über einem Jahr Normalgewicht gehabt, einen Sport, eine Ausbildung, einen passenden Freundeskreis gefunden. Ihre Ausbildung im Hotelgewerbe hat sie verloren, da das Hotel schließen musste. Ihr Sport durfte seit März nicht mehr stattfinden, von ihren Freund:innen zog sie sich zunehmend zurück und mit aller Kraft brach sich die Magersucht erneut ihren Weg.
Da sind die Jugendlichen auf Entzug, die sich einschmeißen, was sie kriegen können, um das Loch in sich zu füllen, das die Einsamkeit hinterlässt.
Viele jungen Menschen werden uns mit akuten Psychosen vorgestellt. Das ist ungewöhnlich in dem Alter. Psychosen werden bei Menschen, die eine Neigung dazu haben, oft durch äußere Belastungsfaktoren ausgelöst – genauso häufig aber durch hohen Cannabiskonsum.
Dann sind da die Kinder, bei denen sich jetzt offenbart, wie viel Gewalt sie in den letzten Monaten erfahren haben. Gewalt, die unbemerkt blieb und für die Kinder umso belastender war, als sie nicht in die Schule gingen und es wenig gute Momente gab, die das noch ausgeglichen haben. Wir suchen mit dem Jugendamt nach Unterstützung. Das ist gerade sehr schwer, denn die Jugendämter sind aktuell überlastet. Beantragte Hilfen werden genehmigt, doch nicht umgesetzt, da das Personal fehlt.
Selbst erfahrene Pflegestellen rufen immer wieder die Polizei, weil es zu Hause über dem Home Schooling eskaliert. Unsere Warteliste ist zum bersten überfüllt und ein Fall ist dringender, als der andere.
Wir erleben Kinder, die den Übergang in eine neue Klassengemeinschaft nicht gut meistern können. Die Lehrer:innen berichten, in den Klassen sei viel Streit. Die Kinder finden schwer zueinander.
Ein Jahr Verzicht auf Körperkontakt, Mimik, normales, altersgerechtes Verhalten, einen großen Teil der gewohnten Freizeit und die gewohnten Strukturen haben ihre Spuren bei vielen Kindern und Jugendlichen hinterlassen. Manches wird jetzt schon deutlich, einiges anderes werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten spüren.
Vielen sozial ängstlichen Kindern geht es ohne die Schule aktuell besser. Auch von Mobbing Betroffene atmen vielfach gerade auf. Was ihnen fehlt ist die Lernerfahrung, dass sie Selbstvertrauen gewinnen und Mobbing mit professioneller Hilfe aufhören kann. Diese Kinder fürchten den Neubeginn der Schule und man kann auch diese Kinder verstehen. Mit dem Wegfall der Freizeit fehlt ihnen leider auch ein schulunabhängiges Übungsfeld für positive Erfahrungen.
Unsere Patient:innen sind jünger, belasteter als sonst und kommen mehr und mehr aus Familien, die vor der Pandemie als unbelastet galten. Es gibt keine einfachen Lösungen in der schweren Situation der Pandemie, in der wir uns befinden. Viele meiner Kolleg:innen und ich wünschten uns, dass die Kinder und Jugendlichen mit ihren Grundbedürfnissen nach sozialem Kontakt und Erfahrungen, Körperkontakt und dem Wahrgenommen werden endlich in das gesellschaftliche Blickfeld geraten. Damit sie nicht nur die Kosten der Pandemiebekämpfung tragen, sondern auch ihre psychische Gesundheit geschützt und erhalten wird.
Ein Blick in die Forschung – wie geht es Kindern & Jugendlichen
JuCo-Studie der Uni Hildesheim
Junge Menschen in Bildungsübergängen sind derzeit besonders gravierend betroffen. Viele haben Zukunftsängste und sehen sich überfordert, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie sind unsicher, ob sie die notwendigen Bildungsinhalte mitbekommen und die Verlagerung auf digitales Lernen angemessen bewältigen. Praktika sind vielfach ausgefallen, Auslandesaufenthalte
konnten nicht angetreten werden, Qualifikationsziele nicht von allen in gleicher Form erreicht werden. Hier wird es noch Jahre dauern, bis dieses von vielen jungen Menschen wieder ausgeglichen werden kann.
Die anfangs getroffenen Regelungen und Maßnahmen waren oftmals für bestimmte Zielgruppen und Lebensformen nicht umsetzbar. Hier zeigte sich, dass Politik bestimmte Lebenssituationen
von Personen nicht im Blick hatte. Hierauf machen die jungen Menschen in der JuCo Studie aufmerksam. Gerade Personen und Familien, die marginalisiert sind und unter prekären Lebensbedingungen leben (z. B. junge Wohnungslose, Care Leaver*innen oder junge Menschen mit Behinderungen)
sowie alternative Lebensformen neben der sog. Kleinfamilie (z. B. stationäre Wohngruppen, Fernbeziehungen oder größere WGs) waren nicht im Blick. Junge Menschen, die allein leben, die
sich in einer betreuten Wohnform (Jugendwohngruppen) oder in Konfliktsituationen mit Erwachsenen
in ihrem Umfeld befinden, werden bisher kaum gesehen.
Dieser Beitrag ist Teil unserer Aktionswoche „365 Tage Kinderrechte im Lockdown – Jetzt echte Priorität für Kinder“.
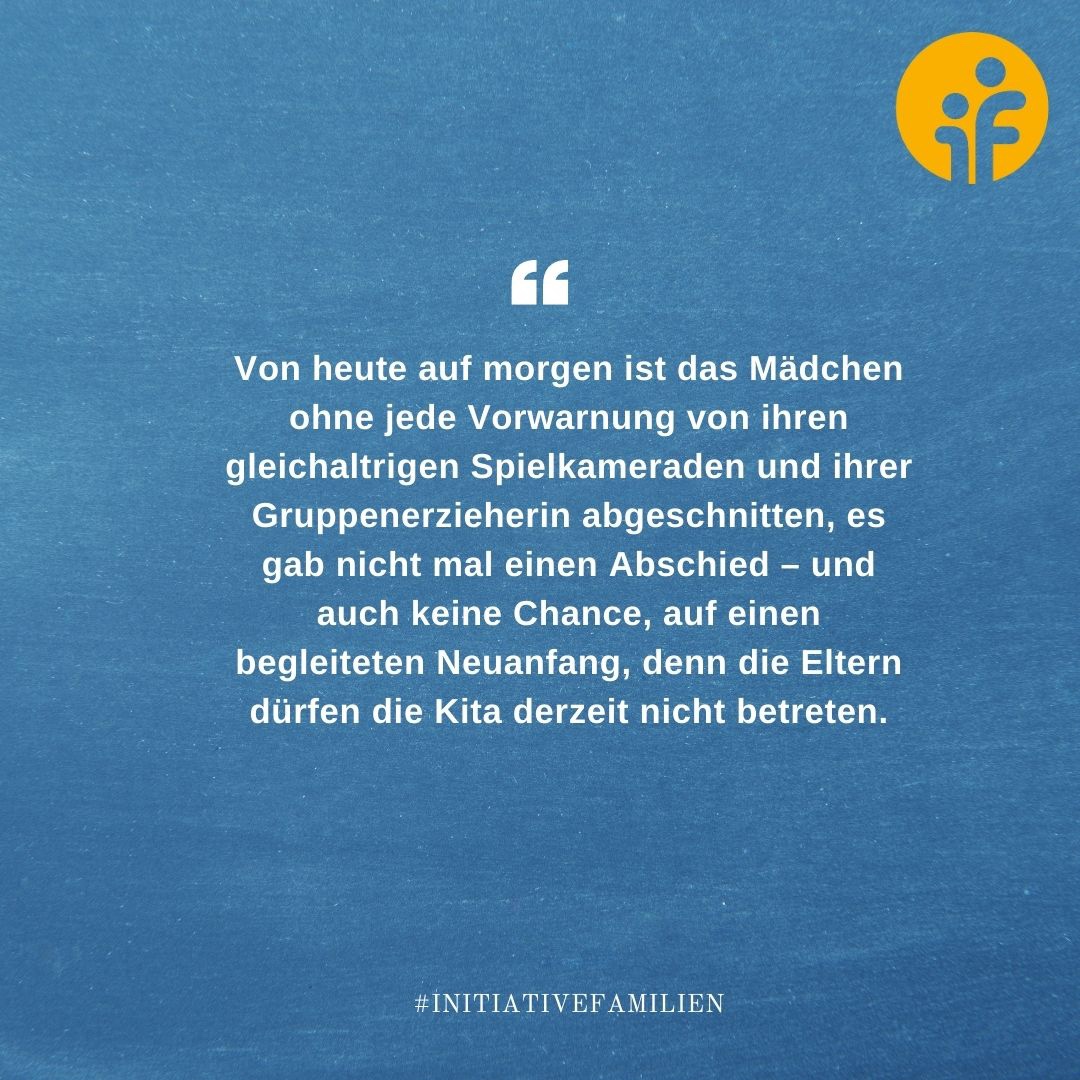
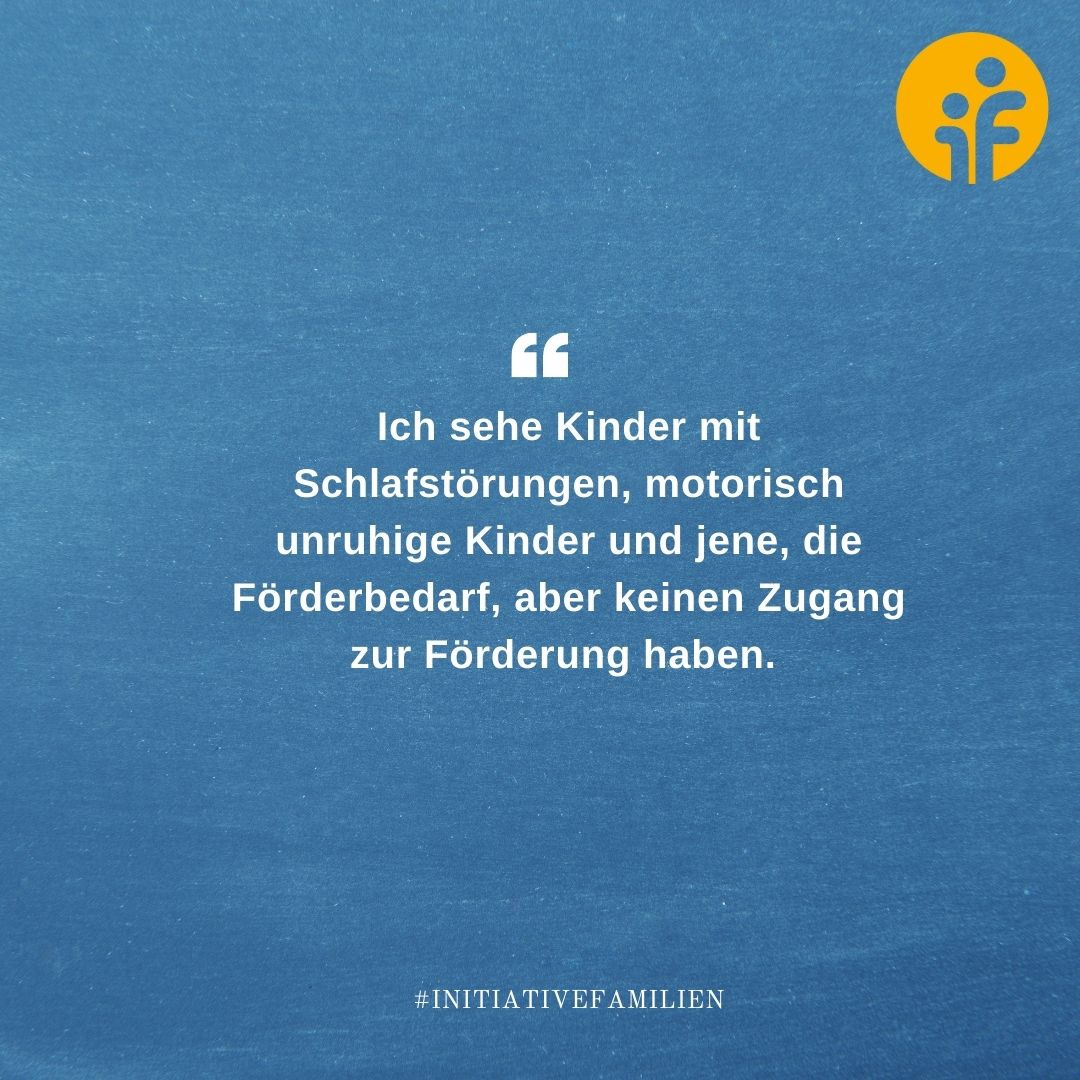
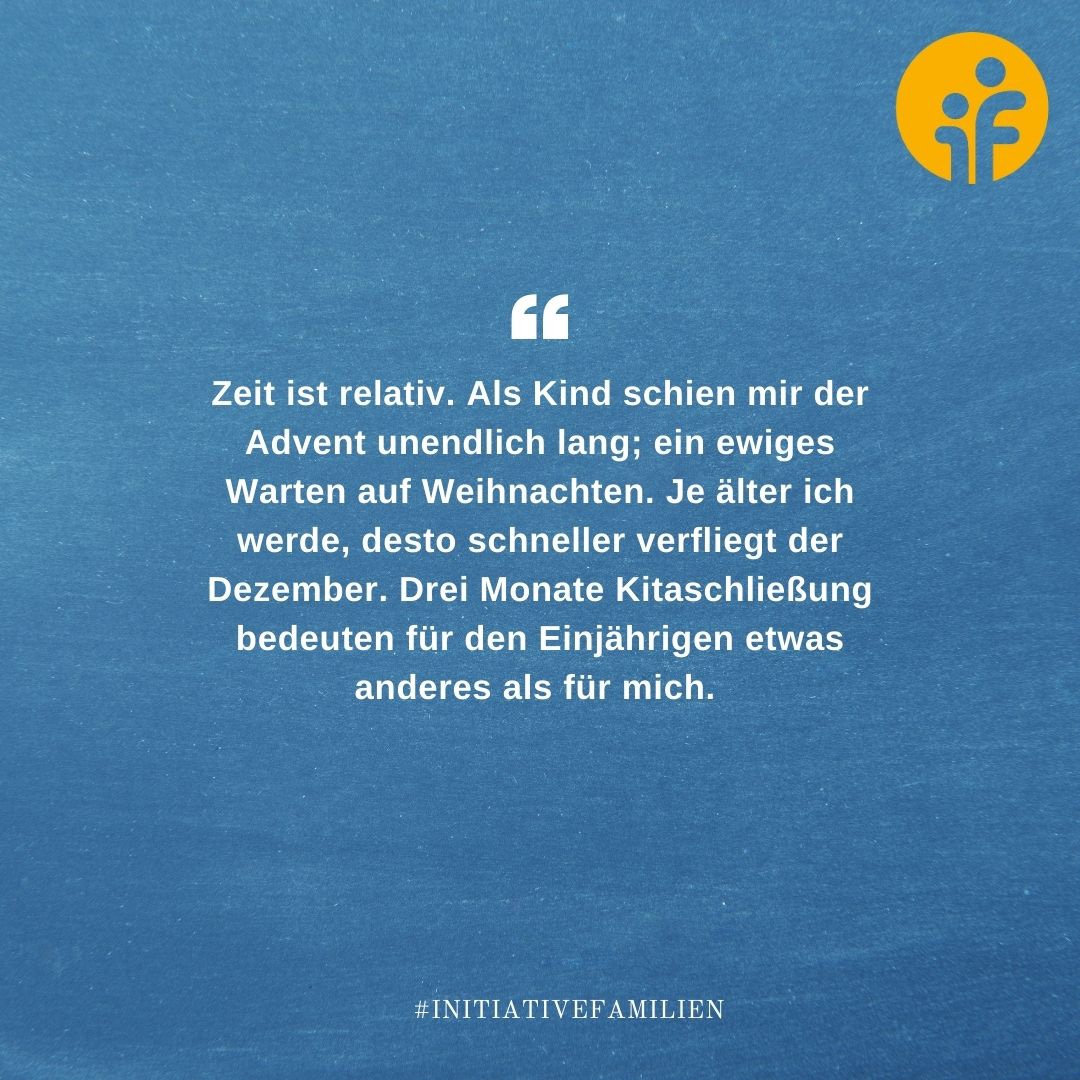
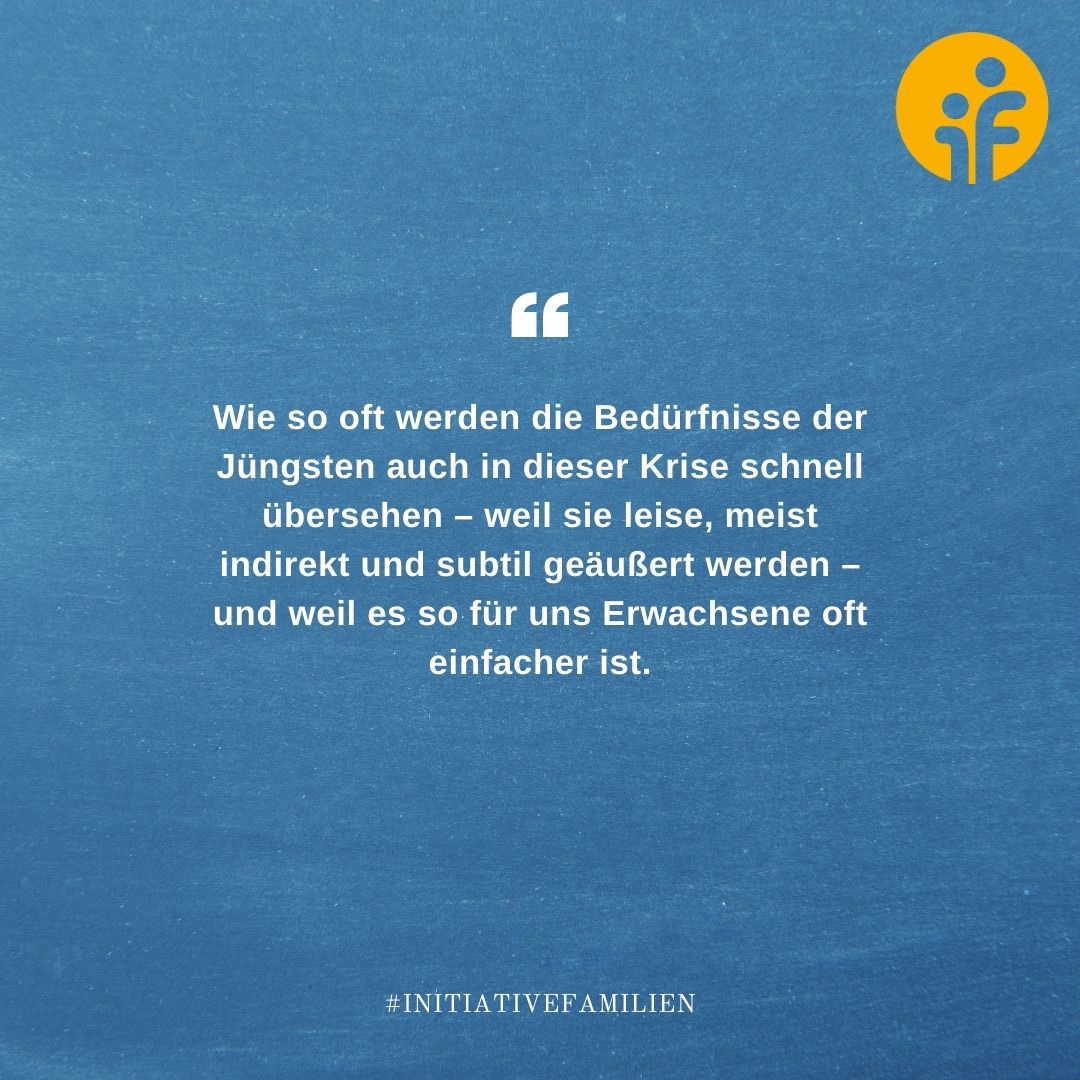
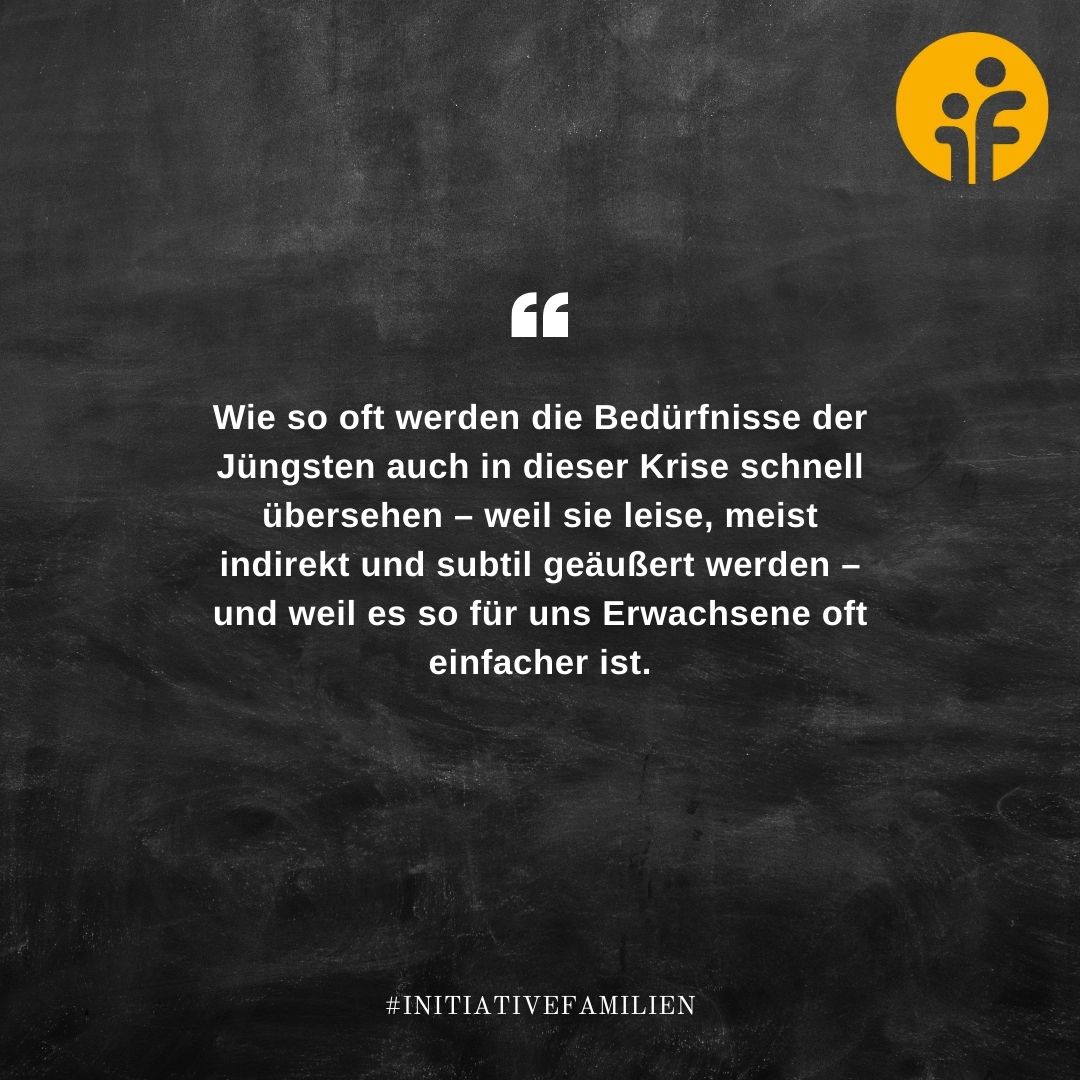
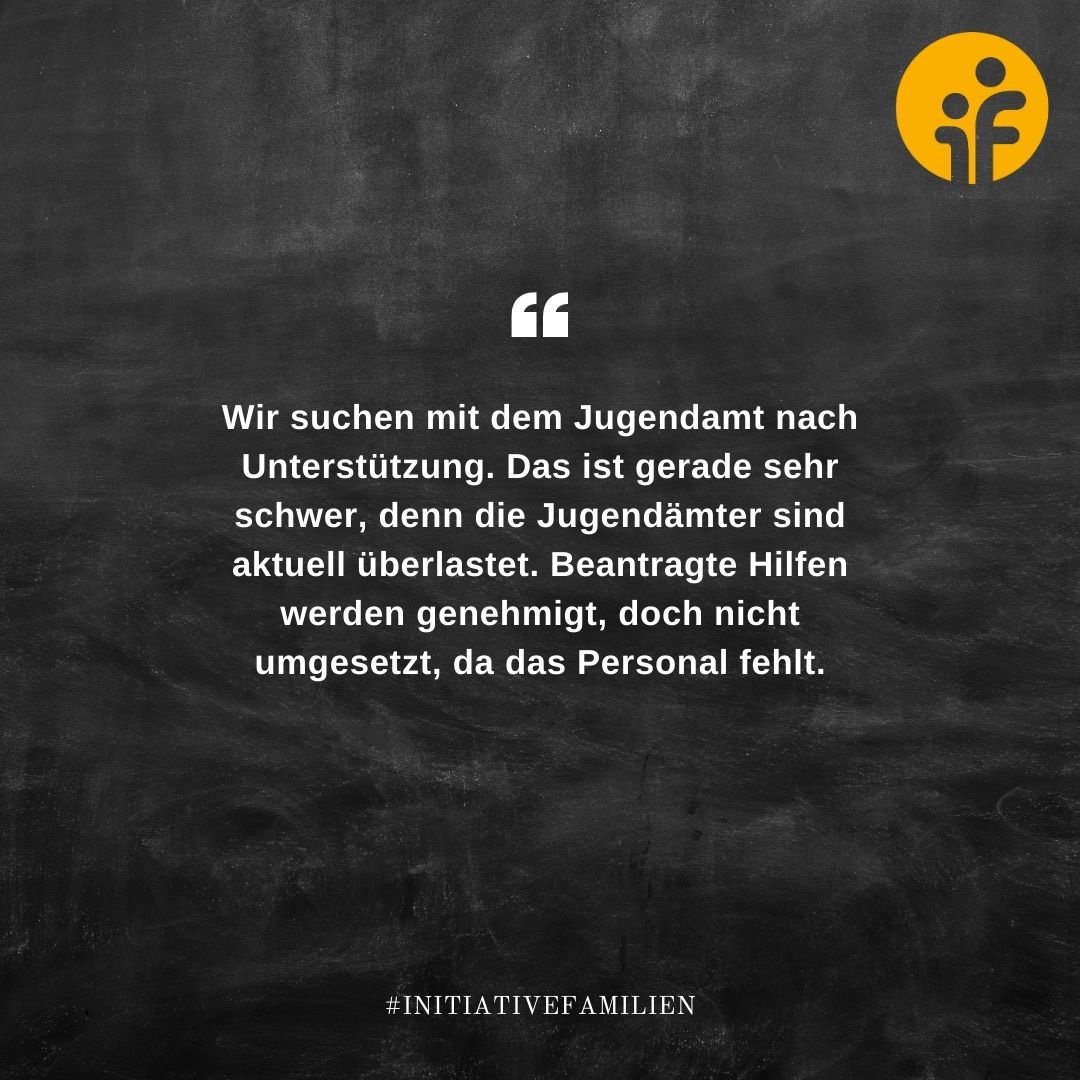
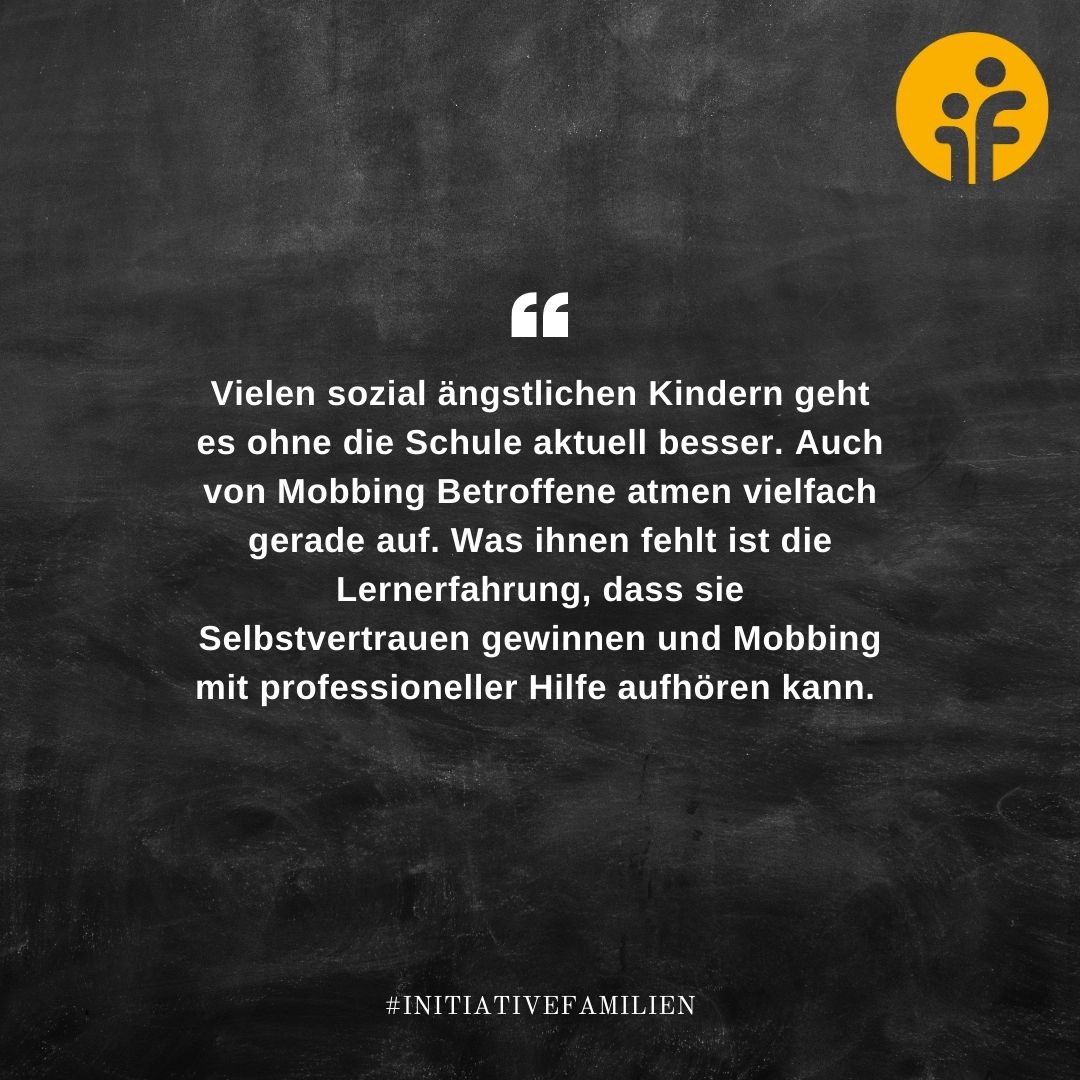
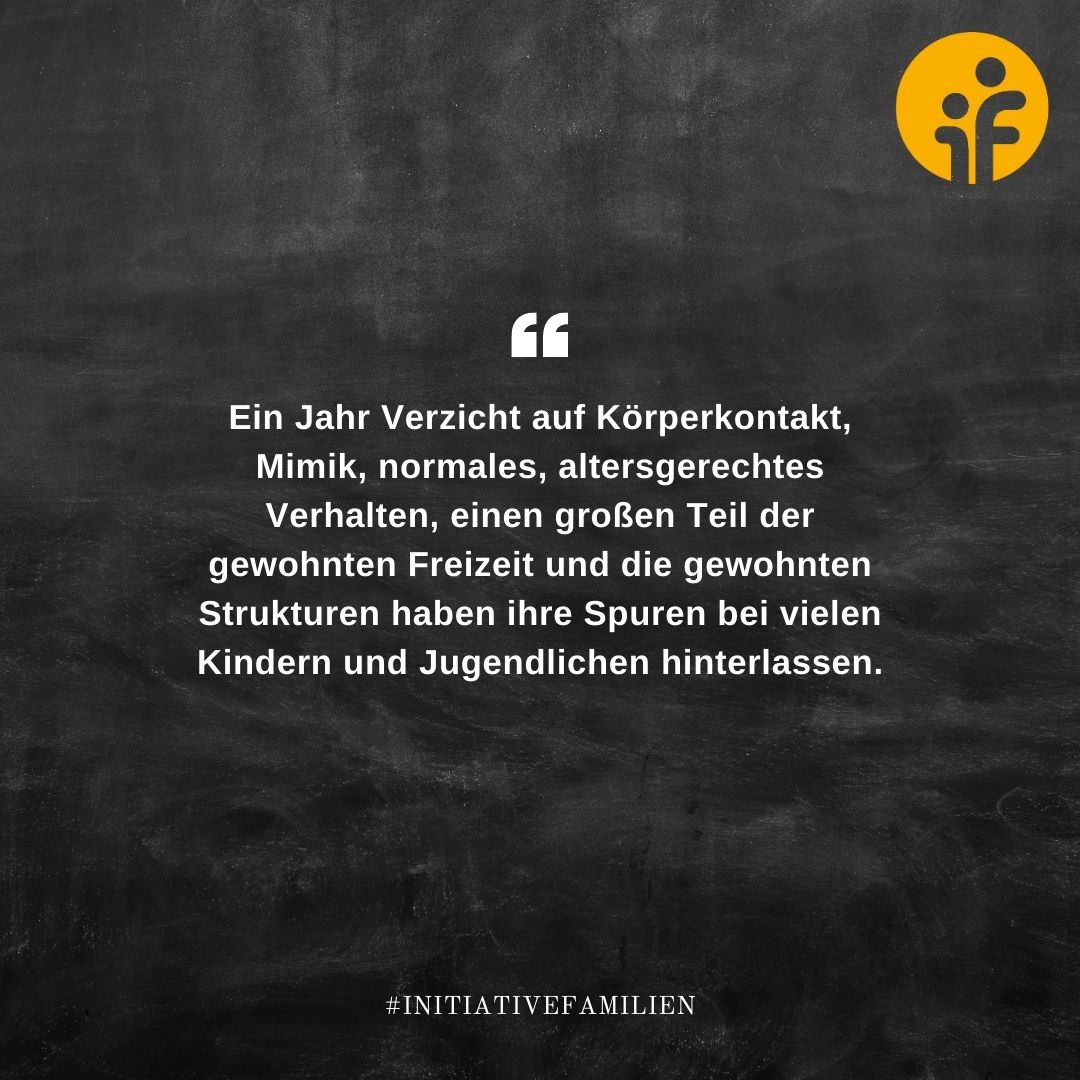


0 Kommentare